Pressekontakt

Richard Harnisch
IÖW-Pressestelle
+49–30–884 594-16
presse(at)ioew.de
Anmelden zum IÖW-Presseverteiler
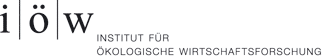
Pressebereich des IÖW
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen aktuelle Mitteilungen des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung sowie Hintergrundinformationen und Bildmaterial zu unseren Forschungsthemen zur Verfügung.
Gerne beantworten wir Ihre Medienanfragen und vermitteln Interviews zu unseren Wissenschaftler*innen. Wenden Sie sich per Telefon oder E-Mail an uns.
Pressemitteilungen
22. März 2024
IÖW: Stakeholder bei Standards für Nachhaltigkeitsreporting beteiligen
In einem offenen Brief an das Bundesjustizministerium fordern 16 zivilgesellschaftliche Organisationen einen Neustart bei der Setzung von Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen. Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) unterstützt diesen Vorstoß und weist darauf hin, dass eine breite Stakeholderbeteiligung bei der Standardentwicklung essenziell ist, um Unabhängigkeit sicherzustellen und Interessenkonflikten vorzubeugen.
20. März 2024
Von Agrardiesel bis Heizungswende: Wie Politik und Zivilgesellschaft Konflikte besser aushandeln können
Das Gebäudeenergiegesetz oder die Kürzungen von Agrardieselsubventionen haben gezeigt: Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz stoßen zurzeit auf heftige Kritik, was rechtspopulistische Akteure für sich nutzen. Heute ist es dringender denn je, soziale Gerechtigkeit in der Transformationspolitik zu verankern. Dies betont das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) im Impulspapier „Transformation gemeinsam gestalten“. Die Forschenden empfehlen eine Neuausrichtung, wie Staat und Zivilgesellschaft bei der Politikgestaltung zusammenwirken: Durch geeignete Aushandlungsräume und eine produktive Gesprächskultur könnten betroffene Interessen und Zielkonflikte in Gesetzgebungsverfahren frühzeitig abgewogen werden. Die mit Förderung von der Open Society Foundations erarbeiteten Empfehlungen stellt das IÖW heute auf einer Diskussionsveranstaltung in Berlin vor.
13. März 2024
Digitalverantwortung der Wirtschaft: IÖW empfiehlt Gründung einer Allianz
Von Künstlicher Intelligenz über Blockchain bis hin zu digitalen Plattformen: Digitaltechnologien werfen ethische, soziale und ökologische Fragen auf. Unternehmen aller Branchen stehen beim Einsatz digitaler Tools vor anspruchsvollen Herausforderungen rund um die Gewährleistung von Datenschutz und -sicherheit aber auch beim Ressourcen- und Klimaschutz. Um dieses Feld der Unternehmensverantwortung strategisch weiterzuentwickeln, sollten Politik, Verbände und Multiplikatoren das Thema Corporate Digital Responsibility (CDR) gemeinsam fördern. Dies empfiehlt das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) im heute veröffentlichten Impulspapier „Eine Allianz für CDR bilden“. Die Empfehlungen hat das IÖW mit Förderung durch die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege des Landes Berlin gemeinsam mit Praxisakteuren entwickelt.
14. Februar 2024
200 Studien ausgewertet: Hilft oder schadet die Digitalisierung der Umwelt?
Smarte Geräte und Rechenzentren verbrauchen viel Ressourcen und Energie. Einige digitale Technologien können sich jedoch positiv auf die Umwelt auswirken, etwa wenn mit ihrer Hilfe Strom und Heizung in Gebäuden automatisch gesteuert werden. Kann die Wissenschaft bereits einschätzen, wie sich negative und positive Umwelteffekte der Digitalisierung zueinander verhalten? Rund 200 Studien haben das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und Technopolis Deutschland im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) analysiert. Fazit: In Gebäuden, im Energiesystem und im Verkehr gibt es Anzeichen für positive Wirkungen, doch in den meisten Bereichen braucht es mehr belastbare Zahlen.
31. Januar 2024
Gebäude begrünen, Bäume und Freiflächen schützen: Forschung unterstützt Städte bei der Klimaanpassung
Um sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen, haben Städte eine wirksame natürliche Ressource: das Stadtgrün. Doch wie werden Bestandsquartiere grüner und wie lassen sich klimaangepasste Neubauprojekte realisieren? Oft mangelt es nicht an gutem Willen, wenn Dach- oder Fassadenbegrünungen geplant werden sollen, sondern an Beispielen und konkreten Lösungsvorschlägen. Darum unterstützt das Forschungsprojekt „Grüne Stadt der Zukunft“ Kommunen und Stadtplaner*innen mit Umsetzungshilfen für die klimaresiliente Planung. In dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt arbeiteten Forschung und Praxis eng zusammen, um Steckbriefe, Checklisten und Leitfäden für grüne, klimaangepasste Städte zu entwickeln.
25. Januar 2024
KI verbraucht immer mehr Ressourcen: jetzt Nachhaltigkeit messen
Die Ausbreitung Künstlicher Intelligenz (KI) heizt die Diskussion über ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt an. Wie viele Ressourcen KI-Anwendungen benötigen, ist zu großen Teilen unbekannt, obwohl viele Daten längst automatisch gemessen werden könnten – etwa wie oft Berechnungen durchgeführt werden und wie lange diese Prozesse dauern. Darauf weisen Forscher*innen des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) hin. Gemeinsam mit der Nichtregierungsorganisation AlgorithmWatch und dem Distributed Artificial Intelligence Labor der Technischen Universität Berlin haben sie mit Förderung des Bundesumweltministeriums im Leuchtturmprojekt „SustAIn“ drei Jahre lang untersucht, wie KI-Anwendungen nachhaltiger werden können. In ihren Empfehlungen fordern sie nun dazu auf, dass Nachhaltigkeitswirkungen von KI entlang des Lebenszyklus stärker gemessen und die Entwicklung und Nutzung von KI-Systemen reguliert werden müssen.
18. Januar 2024
Potenzialanalyse: Abwärme könnte bis zu 10 Prozent des zukünftigen Wärmebedarfs Berlins decken
In Betrieben wie Rechenzentren, Großbäckereien oder Kaffeeröstereien entsteht viel Wärme, die bislang meist ungenutzt in die Umwelt abgegeben wird. Die Summe all dieser Wärme kann eine wichtige Energiequelle darstellen, um mit ihr zu heizen. Ein Projekt zeigt nun, dass das Land Berlin bis zu zehn Prozent des zukünftigen Wärmebedarfs aus solcher Abwärme decken kann. Die Analyse des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und des Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu) zeigt, mit welchen Maßnahmen die Stadt gezielt die Nutzung von Abwärme voranbringen und als einen Baustein in die Berliner Wärmeplanung einbauen kann. Sie wurde im Auftrag der Berliner Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt erstellt.
Zur Pressemitteilung
28. November 2023
Gegen Leerstand und Landflucht: Wie soziale Innovationen ländliche Regionen stärken können
Weit entfernte Supermärkte und Arztpraxen, Wegzug, Leerstand und demografischer Wandel: Viele ländliche Gemeinden sorgen sich um ihre Zukunft. Um ihre Kommunen lebenswerter zu machen, engagieren sich Bewohner*innen auch selbst: etwa in selbstorganisierten Veranstaltungszentren, regionalen Lebensmittelläden, gemeinschaftlichen Werkstätten oder Seniorencafés. Diesen Ideenreichtum sichtbar zu machen, hat sich das Forschungsprojekt „WIRinREGIONEN“ vorgenommen. Wissenschaft und Praxis untersuchen in Sachsen-Anhalt und Brandenburg regionale Netzwerke und bestehende Initiativen. Ihr Ziel: ländliche Gemeinschaften zu fördern und strukturelle Probleme anzugehen.
27. November 2023
Geoenergieallianz Berlin-Brandenburg gegründet
Gemeinsame Forschungsvorhaben, Demonstrationsprojekte und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses stehen im Mittelpunkt der neu gegründeten Geoenergieallianz Berlin-Brandenburg (GEB²). Acht Partnereinrichtungen aus Wissenschaft und Forschung, darunter das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), haben dazu einen Kooperationsvertrag in Berlin unterzeichnet. Die Geoenergieallianz macht in einem Positionspapier deutlich, dass Geoenergie sowohl für das Land Berlin als auch das Land Brandenburg ein zentraler Baustein für die Energiewende ist und sie schlägt Umsetzungsschritte zur Nutzung des geoenergetischen Potenzials vor.
24. November 2023
Studie: Wasserstoffwirtschaft braucht Richtungssicherheit
Seit drei Jahren hat Deutschland eine Nationale Wasserstoffstrategie. Doch der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft verläuft weiterhin träge. Das Problem ist fehlende politische Richtungssicherheit, wie eine aktuelle Studie von Borderstep Institut und Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) zeigt. Die Forschenden weisen darauf hin, dass sich zentrale Akteure nicht einig sind, wie Wasserstoff produziert und wo er eingesetzt werden sollte. Auch die Bundesregierung beziehe keine hinreichend klare Position, so die Studie mit Förderung durch das Bundesforschungsministerium in der Förderrichtlinie „Insight“ zur Innovationsfolgenabschätzung. Dies birgt die Gefahr, dass wichtige Investitionen verzögert oder fehlgeleitet werden könnten. Aufbauend auf einer Analyse des aktuellen Policy-Mix geben die Institute im Papier „Priorisierung und Richtungssicherheit als Aufgabe der Wasserstoffpolitik“ Empfehlungen, wie der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft beschleunigt werden kann.
21. November 2023
Nachhaltige Transformation von Energie, Mobilität und Ernährung: Forschung lenkt Fokus von Zielen auf reale Veränderungsprozesse
Bestehende Konsum- und Produktionssysteme, die natürliche Ressourcen nutzen, um den gesellschaftlichen Bedarf an Nahrung, Wohnraum, Energie und Gesundheit zu decken, sind nicht nachhaltig. Forschende aus soziotechnischen und sozial-ökologischen Disziplinen wollen nun enger zusammenarbeiten, um besser zu verstehen, wie diese Systeme nachhaltiger werden können. Ein Sonderheft der Proceedings of the National Academy of Sciences, das von Forschern der Universität Manchester, des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und der Harvard University herausgegeben wurde, stellt neue Erkenntnisse über Transformationen in Strom-, Ernährungs- und Mobilitätssystemen vor.
11. Oktober 2023
Wie Kommunen sich bei der Energiewende gegenseitig stärken können
Was ihre Energieversorgung betrifft, müssen sich Kommunen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten neu erfinden. Die Aufgaben sind enorm. Aber wo fängt man an? Die Herausforderungen jeder Gemeinde mögen spezifisch sein, aber bei der Erarbeitung von Konzepten sind sie nicht allein. Austausch und Vernetzung untereinander kann sie bei der Bewältigung der Energiewende vor Ort unterstützen. Wissenschaft und Praxis haben ein neues Format entwickelt, wie dies gelingen kann: Kommunale Lernwerkstätten. In Sachsen-Anhalt haben das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), das Zentrum Technik und Gesellschaft (ZTG) der Technischen Universität Berlin und das Bündnis Energieavantgarde Anhalt das Format erprobt.
4. Oktober 2023
Reparieren erleichtern: Wie die Politik langlebige Produkte fördern kann
Über 1.500 Repair-Cafés gibt es in Deutschland. Hier helfen Ehrenamtliche dabei, defekte Elektrogeräte, Fahrräder oder Kleider vor dem Müllcontainer zu retten. Der internationale Repair Day am 21. Oktober soll noch mehr Menschen zum Reparieren ermutigen. Jedoch erfordert Reparieren nicht nur Geschick, sondern auch politisches Handeln: Der Verein Runder Tisch Reparatur macht sich daher für langlebige Produkte und eine Förderung der Reparaturkultur stark. Im Forschungsprojekt SDGpro zeigt das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), dass solche zivilgesellschaftlichen Impulse wichtig sind, um Unternehmen auf einen Nachhaltigkeitskurs zu bringen. Das Projekt, das vom Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz gefördert wurde, empfiehlt, ehrenamtliche Reparatur-Initiativen zu stärken und Feedbacks zur Reparierbarkeit von Produkten an Unternehmen zu übermitteln.
21. September 2023
„Soziale Innovationen stärker fördern“: Alexandra Dehnhardt in Forum Zukunftsstrategie berufen
Heute nimmt das „Forum Zukunftsstrategie“ des Bundesforschungsministeriums (BMBF) seine Arbeit auf. Bei der Umsetzung der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation berät das Gremium aus 21 Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft die Bundesregierung und ihre ressortübergreifenden Missionsteams, mit denen die Forschungs- und Innovationspolitik zwischen den Politikfeldern koordiniert werden soll. Die Wissenschaftlerin Alexandra Dehnhardt vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) in Berlin ist als einzige Vertreterin eines unabhängigen Nachhaltigkeitsforschungsinstituts in das Forum berufen worden.
29. August 2023
Künstliche Intelligenz: Bewertungstool zeigt, wie KI-Systeme nachhaltiger werden können
Mit der Einführung von ChatGPT hat die Künstliche Intelligenz (KI) einen Aufmerksamkeitsschub erhalten. Dabei geraten neben Risiken wie Diskriminierung oder Desinformation auch die wachsenden Ressourcenverbräuche für mehr Rechenleistung stärker ins Zentrum der Debatte. Unterstützung bietet nun ein neues Onlinetool zur Bewertung der Nachhaltigkeit von KI. Das kostenlose Tool von AlgorithmWatch (AW), Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und Distributed Artificial Intelligence Laboratory der Technischen Universität Berlin basiert auf einem Kriterien- und Indikatorenset für nachhaltige KI, das in dem Forschungsprojekt SustAIn mit Förderung durch das Bundesumweltministerium entwickelt wurde.
29. August 2023
Halbzeit für die Ampel – Nachhaltige Digitalpolitik muss jetzt Fahrt aufnehmen
Das Bündnis Bits & Bäume kritisiert zur Halbzeit der Legislatur eine bislang enttäuschende Umsetzung der Digitalpolitik der Bundesregierung. Daher fordert es gemeinsam mit 20 Akteuren aus der Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Open-Source-Wirtschaft: Die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen im Bundestag müssen jetzt dringend ihre digitalpolitischen Versprechen aus dem Koalitionsvertrag umsetzen und dafür im Haushalt 2024 ausreichend Mittel bereitstellen. Das Bündnis, zu dem auch das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) gehört, weist darauf hin, dass es in dieser Legislatur noch ein kurzes Zeitfenster dafür gibt, Deutschland auf einen nachhaltigen, inklusiven digitalpolitischen Kurs zu lenken.
5. Juli 2023
Bundesversammlung des kooperativen Wirtschaftens: Akteure fordern strukturelle Unterstützung
Der vom Bundesforschungsministerium geförderte Projektverbund „Teilgabe – kooperatives Wirtschaften in der Zivilgesellschaft“ hat erstmals Akteure aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen zu einer Bundesversammlung des kooperativen Wirtschaftens zusammengebracht. Das Vernetzungstreffen zeigt, wie sehr die Beteiligten von einem sektorübergreifenden Austausch in Rechts-, Sozial- und Digitalisierungsangelegenheiten profitieren können. Ihre Forderung: Gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, das oft auf freiwilliger Arbeit basiert, muss strukturell gefördert werden.
22. Juni 2023
Innovationen für nachhaltigere Produkte: Forschung rät Unternehmen, Kritik aus Feedback-Apps zu nutzen
Ob ein Produkt Palmöl enthält oder in Einwegplastik verpackt ist, obliegt der unternehmerischen Freiheit. Doch immer mehr Kund*innen wünschen sich nachhaltige Produkte im Einkaufskorb. Mit Apps von Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen können sie Herstellern direkt Feedback geben. Unternehmen sollten dies als Chance betrachten, betonen Forschende vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW). Sie zeigen in einem vom Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz geförderten Leitfaden, wie Unternehmen konstruktiv mit Verbraucher*innen-Apps umgehen können – um ihre Kommunikation zu verbessern und nachhaltige Trends frühzeitig aufzugreifen.
6. Juni 2023
So geht nachhaltige Digitalisierung – Bits & Bäume-Buch gibt 28 Impulse
Von künstlicher Intelligenz über die Umweltauswirkungen der Digitalwirtschaft bis zu globaler Gerechtigkeit: Der digitale Wandel hat viele Baustellen. Und er birgt Risiken. Wie die Gesellschaft nachhaltig digital werden kann, zeigt das Buch „Shaping Digital Transformation for a Sustainable Society“, das heute von dem Bündnis Bits & Bäume auf der Digitalkonferenz Republica in Berlin vorgestellt wird. 28 Beiträge von 68 Autor*innen aus Praxis, Zivilgesellschaft und Forschung zeigen Probleme der digitalen Entwicklungen und geben Impulse, wie Digitalpolitik jetzt gestaltet werden kann und muss. Das englischsprachige Buch steht als reine Online-Publikation kostenlos zum Open-Access-Download bereit.
16. Mai 2023
Seniorengemeinschaften besser unterstützen: Projekt „Teilgabe“ erhält Deutschen Demografie-Preis
Länger in den eigenen vier Wänden leben: Um älteren Menschen das zu ermöglichen, erbringen Seniorengemeinschaften pflegeergänzende Dienstleistungen. Doch wirtschaftlich stabil zu arbeiten, fällt vielen nicht leicht. Eine Dachorganisation könnte dabei helfen, solche Einrichtungen effizient zu verwalten und Kosten zu sparen. Für dieses Konzept wurde der Projektverbund „Teilgabe – kooperatives Wirtschaften in der Zivilgesellschaft“ mit dem Deutschen Demografie-Preis ausgezeichnet. In dem vom Bundesforschungsministerium geförderten Projekt unter Leitung des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) hat die Genossenschaft Innova das Konzept im Teilprojekt „Verbundorganisation der Nachbarschaftshilfen und Seniorengenossenschaften“ erarbeitet. Darin zeigen die Forschenden, wie Organisationen und Politik Nachbarschaftshilfen und Seniorengenossenschaften erfolgreich unterstützen können.
4. Mai 2023
Aktive Mobilität: Forschungsgruppe untersucht, wie eine gesunde Verkehrswende gelingt
Mehr Radfahren, zu Fuß gehen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren: Aktive Mobilität fördert nicht nur den Klimaschutz, sondern auch die eigene Gesundheit. Doch wie gelingt der Umstieg im Alltag? Und was bedeuten zunehmende Wetterextreme wie Hitzewellen fürs Radeln und Spazieren? In der Nachwuchsgruppe AMBER untersucht ein interdisziplinäres Forschungsteam, wie sich eine aktive Mobilität auf die Gesundheit und den Klimawandel auswirkt – unter heutigen Bedingungen und in zukünftigen Szenarien. Durch einen Citizen-Science-Ansatz fließen auch Erfahrungen von Bürger*innen ein. Das fünfjährige Projekt unter Leitung des Gesundheitspsychologen Dr. Jan Keller von der Freien Universität Berlin und der Umwelt- und Sozialpsychologin Dr. Vivian Frick vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit insgesamt über 2,3 Millionen Euro gefördert.
3. Mai 2023
Nachhaltiges Ernährungssystem: Europäische Umweltagentur mahnt transformativere EU-Politik an
Die konventionelle Produktion und der Konsum von Lebensmitteln ist weltweit für ein Drittel der Treibhausgasemissionen verantwortlich, sie trägt maßgeblich zum Verlust der biologischen Vielfalt bei und wirkt sich schädlich auf die menschliche Gesundheit aus. Vielfach gewährleistet sie keine fairen wirtschaftlichen Erträge und Lebensgrundlagen für die Akteure der Branche. Die Europäische Kommission hat mit der „Farm to Fork“-Strategie als Teil des Europäischen Green Deals ein Programm für ein nachhaltiges Ernährungssystem vorgelegt und will in diesem Jahr den EU-Rechtsrahmen ehrgeizig weiterentwickeln. Ein neuer Bericht der Europäischen Umweltagentur zeigt, dass diese Umstellung auf ein nachhaltiges Ernährungssystem enorme Veränderungen erfordert, wie Lebensmittel produziert und konsumiert werden.
28. März 2023
Studie gestartet: Mehrweg To-go erfolgreich umsetzen
Was macht erfolgreiche Mehrwegsysteme aus und wie profitiert die Umwelt am meisten? Dazu forschen das Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu) und das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) im Projekt REPAID. Auch die Anbieter RECUP und Vytal sind an dem Projekt beteiligt, das vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gefördert wird.
21. März 2023
Recherchetool „Umweltzeichen Kompakt“: Orientierungshilfe bei der Beschaffung nachhaltiger biobasierter Produkte
Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) hat in Kooperation mit dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) den Gütezeichen-Finder „Umweltzeichen Kompakt“ veröffentlicht – eine Orientierungshilfe für den umweltfreundlichen Einkauf von Produkten und Dienstleistungen mit nachwachsenden Rohstoffen. Das Recherchetool ist vornehmlich ein Angebot für Mitarbeitende in Behörden und öffentlichen Einrichtungen, richtet sich aber auch an Endverbraucher*innen und alle am umweltfreundlichen Einkauf Interessierte.
9. März 2023
Agri-Photovoltaik: Wie die Energiewende auf dem Acker vorankommt
Wohin mit all den Solaranlagen, die für die Energiewende nötig sind? Neben Dächern können sich auch landwirtschaftliche Flächen wie Äcker und Wiesen eignen, um Sonnenstrom zu erzeugen. Salat, Spargel, Himbeeren und andere empfindliche Kulturen gedeihen gut im Halbschatten von Solarmodulen. Das Konzept der Agri-Photovoltaik kann für Landwirt*innen vor allem an trockenen Standorten rentabel sein. Doch für Netzanschluss und Genehmigungsverfahren fehlen praxistaugliche Lösungen, wie Forschende vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und der Hochschule Kehl (HSK) im Projekt Landgewinn mit Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zeigen. Sie empfehlen mehr Kooperationen mit Netzbetreibern und rechtliche Verbesserungen.
6. März 2023
Konsequenter Klimaschutz und vorsorgende Klimaanpassung verhindern Milliardenschäden
Neue Studie zeigt aktuelle und potenzielle volkswirtschaftliche Folgekosten der Klimakrise für Deutschland
Gemeinsame Pressemitteilung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit
und Verbraucherschutz zur Studie Kosten durch Klimawandelfolgen in Deutschland von IÖW, Prognos und GWS
Berlin, 15. Februar 2023
IÖW: Wie Unternehmen digitale Verantwortung übernehmen können
Digitale Technologien wie künstliche Intelligenz, Blockchain, Smart City oder autonomes Fahren öffnen neue Geschäftsfelder für die Wirtschaft. Die Gesellschaft kann von solchen Zukunftstechnologien durch Effizienz, Automatisierung und Transparenz profitieren. Doch haben digitale Technologien Risiken und Nebenwirkungen – für die Mitarbeitenden in Unternehmen, für die Umwelt und für die Gesellschaft. Wie Unternehmen im digitalen Wandel systematisch Verantwortung übernehmen können, zeigt das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) in einer Studie zur „Corporate Digital Responsibility“ (CDR). Die Forschenden analysierten Nachhaltigkeitsberichte von über 60 deutschen Großunternehmen und schlussfolgern, dass die Unternehmen über die Branchen hinweg ihre Rolle als Nutzer digitaler Angebote stärker beachten müssen. Dabei geht es um Themen wie Datenschutz, ethische Fragen künstlicher Intelligenz oder die Auswirkungen digitaler Hardware und Infrastrukturen auf den Klimawandel.
Bonn, 17. Januar 2023
Studie zur „smarten“ Landwirtschaft: Was die Politik jetzt tun muss, um biologische Vielfalt zu fördern
Digitale Technologien wie Drohnen, Sensoren, Agrar-Apps und GPS-gesteuerte Roboter könnten eine ökologischere Landwirtschaft ermöglichen, etwa indem der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden verringert wird. Doch damit dies gelingt, braucht es ökologische und soziale Leitlinien, sonst könnte die Digitalisierung bestehende Probleme sogar verschärfen. Das betonen Forschende vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in einer vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) beauftragten Studie, die jetzt in der Reihe der BfN-Schriften sowie in einem Policy Brief veröffentlicht wurde.
Berlin, 12. Januar 2023
Innovativ für eine bessere Welt: Toolbox „PICI“ misst, wie Privatpersonen online gemeinsam Innovationen entwickeln
Für den sozialen und ökologischen Wandel braucht es viele Lösungsansätze. Jenseits klassischer Forschungs- und Entwicklungsprozesse können Online-Communities hierbei ein Innovationstreiber sein: In Internet-Foren tauschen sich Privatpersonen weltweit über technische Lösungen und deren gesellschaftliche Umsetzung aus. Dabei kommt eine große Menge an Informationen und Lösungsansätzen zusammen. Die Zusammenarbeit in solchen „Peer-Communities“ hat Innovationsprozesse geöffnet, aber auch unübersichtlicher gemacht. Forschende aus dem Projekt „Peer Innovation“ vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und der Technischen Universität Berlin wollen dazu beitragen, solche Innovationen sichtbarer zu machen. Hierfür entwickelten sie eine Open-Source-Toolbox, die dabei hilft, Innovationsaktivitäten von Online-Communities einzuschätzen.
Berlin, 5. Januar 2023
Studie: Smart-Meter-Rollout sollte datensparsam erfolgen
Damit die Energiewende vorankommt, sind „intelligente“ Stromzähler eine wichtige Voraussetzung. Doch der Rollout zur Digitalisierung der Energiewende stockt. Den Durchbruch soll nun ein neues Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende bringen, für das das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) im Dezember 2022 einen Referentenentwurf vorgelegt hat. Forschende des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) haben mit Förderung durch das BMWK untersucht, wie sich Ausbau und Betrieb der digitalen Energieinfrastruktur ökologisch auswirken. Eine Analyse der Verbrauchsdaten von 1.600 Haushalten zeigt: Der Einbau eines Smart Meter führt bislang zu keinen nennenswerten Stromeinsparungen. Um bei der Digitalisierung der Energiewende die Umwelt zu schonen, empfiehlt das IÖW: Smart Meter sollten so datensparsam wie möglich betrieben werden.

